| Comics / Schrift-Bild-Relation / Bilderwortschatz / Superhelden-Parodie |
| Marius Lechler Die Rückkehr der Superhelden
In einer dunklen Seitenstraße schlägt
die unheimliche Gestalt mit dem Fledermauskostüm einen gefährlich
aussehenden Mann zu Boden. Es gibt wohl kaum ein anderes Medium, in dem die Beziehung zwischen Schrift und Bild und ihre dynamische Verknüpfung so offensichtlich nachzuweisen ist wie im Comic. Die Bewegung wird visualisiert durch Onomatopoesien, also Lautmalereien und "Bewegungslinien". Doch was Comic-Hefte so faszinierend und vor allem interessant für die Beschäftigung mit Schrift und Bild und deren "Beweglichkeit" macht, geht weit darüber hinaus. 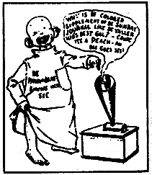 "Comic" bezeichnet inzwischen nicht mehr nur die Abenteuer von
Mickey Mouse und Donald Duck, die für viele Leser ein fester Bestandteil
ihrer Kindheit und Jugend sind. Seit im Jahre 1896 das erste "comic
book", "The Yellow Kid" erschien, hat das Medium Comic
zahlreiche stilistische und künstlerische Veränderungen durchgemacht.
Doch nicht nur der Stil änderte sich, auch die Themen der bunten
Hefte decken inzwischen ein breites Spektrum beinahe aller Bereiche ab,
denen sich auch Literatur und Film widmen. Von der Geschichte des Holocaust
(Bedürftig, Friedemann/Kalenbach, Dieter: "Hitler - Die Machtergeifung"
& "Hitler - Der Völkermörder", Carlsen 1989; Spiegelman,
Art: "Maus", Rowohlt 1992) bis zum profanen Kochbuch (Uderzo,
Albert/Crabos, Marie-Christine: "Kochspaß mit Asterix",
Egmont Ehapa 1996) ist hier alles zu finden. Dennoch haben fast alle Comic-Publikationen
eines gemeinsam: die Visualisierung von Bewegung steht bei ihnen an erster
Stelle.
"Comic" bezeichnet inzwischen nicht mehr nur die Abenteuer von
Mickey Mouse und Donald Duck, die für viele Leser ein fester Bestandteil
ihrer Kindheit und Jugend sind. Seit im Jahre 1896 das erste "comic
book", "The Yellow Kid" erschien, hat das Medium Comic
zahlreiche stilistische und künstlerische Veränderungen durchgemacht.
Doch nicht nur der Stil änderte sich, auch die Themen der bunten
Hefte decken inzwischen ein breites Spektrum beinahe aller Bereiche ab,
denen sich auch Literatur und Film widmen. Von der Geschichte des Holocaust
(Bedürftig, Friedemann/Kalenbach, Dieter: "Hitler - Die Machtergeifung"
& "Hitler - Der Völkermörder", Carlsen 1989; Spiegelman,
Art: "Maus", Rowohlt 1992) bis zum profanen Kochbuch (Uderzo,
Albert/Crabos, Marie-Christine: "Kochspaß mit Asterix",
Egmont Ehapa 1996) ist hier alles zu finden. Dennoch haben fast alle Comic-Publikationen
eines gemeinsam: die Visualisierung von Bewegung steht bei ihnen an erster
Stelle.
Warum ausgerechnet Superhelden? Die Hefte mit den Helden im Ganzkörper-Gymnastikanzug, die in fremden Welten oder lebensfeindlichen Großstadtmetropolen gegen geniale Gangster und schreckliche Superschurken kämpfen, entnehmen ihre pure Existenzberechtigung dem perfekten Zusammenspiel von Schrift und Bild und der daraus resultierenden "action": Der im "wahren Leben" blinde Superheld Daredevil entdeckt (Siehe Bildbeispiel) die Fähigkeiten seines Blindenstocks und benutzt ihn als Waffe im Kampf gegen das Verbrechen.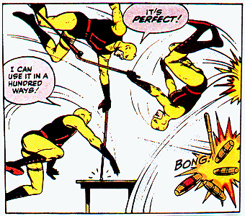 Die bekanntesten Verteter der Gattung "Superheld", nämlich
"Superman" und "Batman", haben sogar über das
Medium hinaus, das sie hervorgebracht hat, Einfluß auf zahlreiche
Bereiche des täglichen Lebens.
Die bekanntesten Verteter der Gattung "Superheld", nämlich
"Superman" und "Batman", haben sogar über das
Medium hinaus, das sie hervorgebracht hat, Einfluß auf zahlreiche
Bereiche des täglichen Lebens.So ist das Superman und Batman - Die Väter der Bewegung 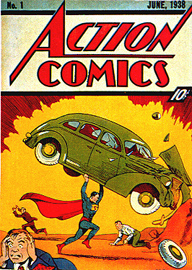 Als die beiden Studenten Jerry Siegel und Joe Shuster 1938 den ersten
Superhelden der Welt in "Action Comics #1" das Licht der Welt
erblicken ließen, dachte wohl keiner der beiden daran, daß ihre
Schöpfung, eine Mischung aus unbesiegbarem Wesen vom anderen Stern
und der Personifizierung konservativer amerikanischer Moralvorstellungen,
einen unverzichtbaren Einfluß auf die gesamte Entwicklung dieses
Comic-Genres haben würde. Superman war seit seinem ersten Auftreten
im Jahre 1938 ein von der Charakterzeichnung her sehr konventioneller
Held, der den "Schurken der Woche" bekämpft, und nachdem
er die Welt (einmal mehr) gerettet hat, wieder in seine geheime Identität
als Reporter Clark Kent schlüpft.
Als die beiden Studenten Jerry Siegel und Joe Shuster 1938 den ersten
Superhelden der Welt in "Action Comics #1" das Licht der Welt
erblicken ließen, dachte wohl keiner der beiden daran, daß ihre
Schöpfung, eine Mischung aus unbesiegbarem Wesen vom anderen Stern
und der Personifizierung konservativer amerikanischer Moralvorstellungen,
einen unverzichtbaren Einfluß auf die gesamte Entwicklung dieses
Comic-Genres haben würde. Superman war seit seinem ersten Auftreten
im Jahre 1938 ein von der Charakterzeichnung her sehr konventioneller
Held, der den "Schurken der Woche" bekämpft, und nachdem
er die Welt (einmal mehr) gerettet hat, wieder in seine geheime Identität
als Reporter Clark Kent schlüpft.
Der Spielraum für außergewöhnliche Bildgestaltungen
oder kreative Verwendung von Schrift-Bild-Kombinationen ist bei dieser
Serie bis heute nicht besonders groß. Was man dem "Mann aus
Stahl" jedoch hochanrechnen muß: er hat das berühmte
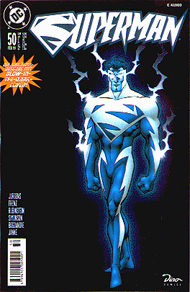 Auch Batman, der dunkle Rächer, der bald nach Superman die Arena
der Gerechtigkeitskämpfer in langen Unterhosen betrat, sorgte zu
Beginn in seinen Abenteuern nicht für besonders erwähnenswerte
Beispiele grafischer Gestaltung. Neue Autoren und Zeichner wie der "Batman-Spezialist"
Frank Miller machten in den 80er Jahren aus dem Gerechtigkeits-kämpfer,
dessen Ruf vor allem durch die alberne TV-Serie "Batman" aus
den 60er Jahren gelitten hatte, einen dunklen und vor allem seelisch gebrochenen
Charakter. In "Die Rückkehr des dunklen Ritters" (1986)
definierte Miller den Mythos von Batman neu. Aus dem Rächer mit dem
Cape wurde ein Mann mit starken psychischen Problemen, ein Superheld,
der unter dem hinterhältigen Mord an seinen Eltern sein ganzes Leben
lang zu leiden hat. Batman verbringt seine Nächte damit, gegen Verbrecher
zu kämpfen, von denen er in Punkto Brutalität und Skrupellosigkeit
oft selbst nicht mehr zu unterscheiden ist. In den "graphic novels",
romanartigen Comic-Büchern fand Batman in den 90er Jahren seine Bestimmung.
In ihnen wurde der künstlerischen Gestaltung der Figur und ihren
Text-Bild-Bezügen bedeutender Raum zugestanden.
Auch Batman, der dunkle Rächer, der bald nach Superman die Arena
der Gerechtigkeitskämpfer in langen Unterhosen betrat, sorgte zu
Beginn in seinen Abenteuern nicht für besonders erwähnenswerte
Beispiele grafischer Gestaltung. Neue Autoren und Zeichner wie der "Batman-Spezialist"
Frank Miller machten in den 80er Jahren aus dem Gerechtigkeits-kämpfer,
dessen Ruf vor allem durch die alberne TV-Serie "Batman" aus
den 60er Jahren gelitten hatte, einen dunklen und vor allem seelisch gebrochenen
Charakter. In "Die Rückkehr des dunklen Ritters" (1986)
definierte Miller den Mythos von Batman neu. Aus dem Rächer mit dem
Cape wurde ein Mann mit starken psychischen Problemen, ein Superheld,
der unter dem hinterhältigen Mord an seinen Eltern sein ganzes Leben
lang zu leiden hat. Batman verbringt seine Nächte damit, gegen Verbrecher
zu kämpfen, von denen er in Punkto Brutalität und Skrupellosigkeit
oft selbst nicht mehr zu unterscheiden ist. In den "graphic novels",
romanartigen Comic-Büchern fand Batman in den 90er Jahren seine Bestimmung.
In ihnen wurde der künstlerischen Gestaltung der Figur und ihren
Text-Bild-Bezügen bedeutender Raum zugestanden.
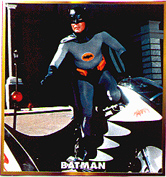
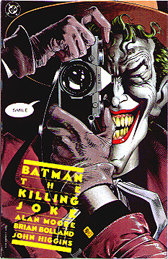 Selbstreferenz - Der Comic nimmt sich selbst aufs Korn Ein wichtiges Gestaltungsmittel des Mediums Comic ist die Möglichkeit, selbstreferentiell zu arbeiten. Das heißt, das Medium Comic beschäftigt sich mit seinen eigenen Mechanismen und Konventionen und nutzt sie, um sich satirisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Diese Art von Comics gab es schon sehr früh in der Geschichte dieser Literaturform.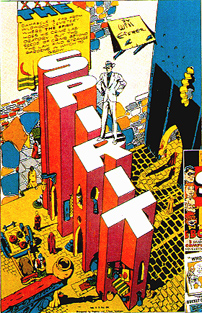 Ein Comic-Künstler, der bereits 1940 das Konzept der Selbstreferentialitüt
verwirklichte, war Will Eisner. Er bezeichnete sich selbst als "visueller
Geschichtenerzähler". Eisner nutzte seinen größten
Erfolg, die Kriminal-Serie "The Spirit", in der ein maskierter
Detektiv die Verbrecher jagt (übrigens einer der ersten Superhelden),
um mit Hilfe von plastischen Schrift-Bild-Kombinationen die exotischen
Abenteuer des Helden zu illustrieren. Im Bildbeispiel nutzt Eisner Schriftzüge
(oft auch in anderen Titelbildern die Titelschrift) als aktives Element
des Bildes, die auch dramaturgische Funktion haben. Der Schriftzug "Spirit"
bildet das Dach mehrerer kleiner Gebäude auf einem orientalischen
Bazar. In den Schatten der Buchstaben sind kleine Haustüren und Fenster
eingelassen, die die Illusion von tatsächlich vorhandenen Gebäuden
aufkommen lassen. Ebenso bemerkenswert ist der sogenannte "Writer´s
Credit", die Autorennennung als Beschriftung auf einem kleinen Vordach.
Eisner machte ein Markenzeichen aus dieser Art von Spiel mit den Konventionen
des Comic-Genres und benutzte sie in der gesamten "The Spirit"-Serie.
Ein Comic-Künstler, der bereits 1940 das Konzept der Selbstreferentialitüt
verwirklichte, war Will Eisner. Er bezeichnete sich selbst als "visueller
Geschichtenerzähler". Eisner nutzte seinen größten
Erfolg, die Kriminal-Serie "The Spirit", in der ein maskierter
Detektiv die Verbrecher jagt (übrigens einer der ersten Superhelden),
um mit Hilfe von plastischen Schrift-Bild-Kombinationen die exotischen
Abenteuer des Helden zu illustrieren. Im Bildbeispiel nutzt Eisner Schriftzüge
(oft auch in anderen Titelbildern die Titelschrift) als aktives Element
des Bildes, die auch dramaturgische Funktion haben. Der Schriftzug "Spirit"
bildet das Dach mehrerer kleiner Gebäude auf einem orientalischen
Bazar. In den Schatten der Buchstaben sind kleine Haustüren und Fenster
eingelassen, die die Illusion von tatsächlich vorhandenen Gebäuden
aufkommen lassen. Ebenso bemerkenswert ist der sogenannte "Writer´s
Credit", die Autorennennung als Beschriftung auf einem kleinen Vordach.
Eisner machte ein Markenzeichen aus dieser Art von Spiel mit den Konventionen
des Comic-Genres und benutzte sie in der gesamten "The Spirit"-Serie.
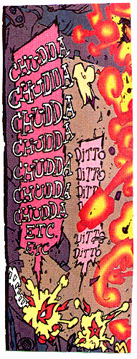 Ein aktuelleres Beispiel für die Anwendung von Selbstreferentialität
in Superhelden-Comics ist die amerikanische Superhelden-Parodie "Trencher".
Hier werden in der laufenden Handlung Schrift-Bild-Elemente verwendet,
um Comic-Konventionen zu demontieren. Zum Beispiel wird die laufende Handlung
durch zahlreich auftauchende Hinweisschilder aufgehalten und in Sprechblasen
werden die Lautmalereien des Comic veralbert. Hier steht der satirische
Aspekt dieses Stilmittels im Vordergrund. Im Beispiel wird eine arbeitende
Maschine durch die Sprechblase "Chudda, Chudda" charakterisiert,
gleichzeitig aber durch eine zweite Sprechblase mit dem Inhalt "Ditto,
Ditto" ins Lächerliche gezogen.
Ein aktuelleres Beispiel für die Anwendung von Selbstreferentialität
in Superhelden-Comics ist die amerikanische Superhelden-Parodie "Trencher".
Hier werden in der laufenden Handlung Schrift-Bild-Elemente verwendet,
um Comic-Konventionen zu demontieren. Zum Beispiel wird die laufende Handlung
durch zahlreich auftauchende Hinweisschilder aufgehalten und in Sprechblasen
werden die Lautmalereien des Comic veralbert. Hier steht der satirische
Aspekt dieses Stilmittels im Vordergrund. Im Beispiel wird eine arbeitende
Maschine durch die Sprechblase "Chudda, Chudda" charakterisiert,
gleichzeitig aber durch eine zweite Sprechblase mit dem Inhalt "Ditto,
Ditto" ins Lächerliche gezogen.The Next Generation  Im Bereich der Superhelden-Comics wurde der deutsche Markt in den letzten
Jahren geradezu überschwemmt von zahlreichen neuen Produktionen aus
den USA. Besonders hervor tat sich dabei der kleine Independent-Verlag
"Image" mit einer kaum übersehbaren Zahl von neuen Heftchen-Reihen:
"Witchblade", "C.Y.B.E.R.Force", "Gen13",
"Darkness", "WildC.A.T.S." sowie andere Reihen dieses
Verlages haben auch in Deutschland eine große Fangemeinde um sich
geschart.
Im Bereich der Superhelden-Comics wurde der deutsche Markt in den letzten
Jahren geradezu überschwemmt von zahlreichen neuen Produktionen aus
den USA. Besonders hervor tat sich dabei der kleine Independent-Verlag
"Image" mit einer kaum übersehbaren Zahl von neuen Heftchen-Reihen:
"Witchblade", "C.Y.B.E.R.Force", "Gen13",
"Darkness", "WildC.A.T.S." sowie andere Reihen dieses
Verlages haben auch in Deutschland eine große Fangemeinde um sich
geschart. 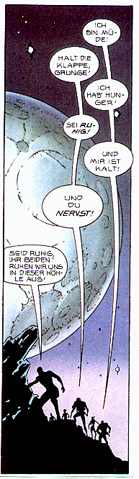 In der Serie "Gen13" z.B. geht es um eine Gruppe von vier Jugendlichen,
bei denen aufgrund geheimer Regierungsexperimente verborgene, genetisch
angelegte Kräfte freigesetzt werden. Diese Gruppe kämpft nun,
nachdem sie dem Zugriff der geheimen Organisation entkommen ist, unter
der Führung ihres Teamleiters John Lynch gegen die Organisation,
die die Jugendlichen wieder in ihre Finger bekommen will. Die in den USA
außerordentlich erfolgreich laufende Serie beinhaltet zahlreiche
emotionale Konflikte, vor allem, weil vier gerade erst dem Teenageralter
entwachsene Helden miteinander auskommen müssen, die oft mit sich
selbst noch mehr Schwierigkeiten haben, als mit den Gegnern, gegen die
sie antreten müssen (wie auch im ersten Bildbeispiel zu sehen ist).
Das zweite Beispiel demonstriert die Verwendung von Lautworten im Bildausschnitt.
Der Haupt-Bildbereich, in dem sich die Handlung abspielt, bleibt unberührt,
der Vordergrund jedoch wird von einer Onomatopoesie, einem Lautwort, wie
es in Comics häufig verwendet wird, durchbrochen. Die Gestaltung
des Lauts als "ohrenbetäubend" und "durchdringend"
wird so visualisiert. Die Reaktion läßt sich an den Gesichtern
der Akteure ablesen.
In der Serie "Gen13" z.B. geht es um eine Gruppe von vier Jugendlichen,
bei denen aufgrund geheimer Regierungsexperimente verborgene, genetisch
angelegte Kräfte freigesetzt werden. Diese Gruppe kämpft nun,
nachdem sie dem Zugriff der geheimen Organisation entkommen ist, unter
der Führung ihres Teamleiters John Lynch gegen die Organisation,
die die Jugendlichen wieder in ihre Finger bekommen will. Die in den USA
außerordentlich erfolgreich laufende Serie beinhaltet zahlreiche
emotionale Konflikte, vor allem, weil vier gerade erst dem Teenageralter
entwachsene Helden miteinander auskommen müssen, die oft mit sich
selbst noch mehr Schwierigkeiten haben, als mit den Gegnern, gegen die
sie antreten müssen (wie auch im ersten Bildbeispiel zu sehen ist).
Das zweite Beispiel demonstriert die Verwendung von Lautworten im Bildausschnitt.
Der Haupt-Bildbereich, in dem sich die Handlung abspielt, bleibt unberührt,
der Vordergrund jedoch wird von einer Onomatopoesie, einem Lautwort, wie
es in Comics häufig verwendet wird, durchbrochen. Die Gestaltung
des Lauts als "ohrenbetäubend" und "durchdringend"
wird so visualisiert. Die Reaktion läßt sich an den Gesichtern
der Akteure ablesen. 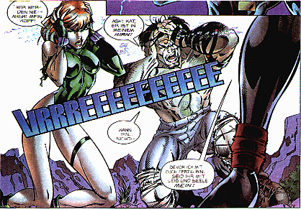
Superhelden Sterben nicht Die zahlreichen Aspekte des Mediums Comic, von denen hier einige vorgestellt wurden, füllen bereits dicke Bücher. Nicht nur Comic-Fans in aller Welt beschäftigen sich mit den bunten Heftchen, auch an Universitäten werden bereits Arbeiten zu diesem Thema geschrieben (Thomas Sieck: Der Zeitgeist der Superhelden. Das Gesellschaftsbild amerikanischer Superheldencomics von 1938 bis 1988. Diplomarbeit. Meitingen 1999; Jens Balzer: Das Wesen des Comics. Über Dialektik und Indifferenz in Bild-Text-Verhältnissen. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Universität Hamburg 1996). Superhelden im allgemeinen mögen zwar mit ihren überkommenen
Moralvorstellungen und ihrer Law-and-Order-Mentalität an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert zu einer aussterbende Rasse gehören. Unzweifelhaft
sind diese Comics aber Beweis dafür, wie das Zusammenspiel von
Schrift und Bild Bewegung hervorbringt und in vielfältiger Weise
die Leser dieser Literaturerzeugnisse auch heute noch anspricht. Superhelden
sind die heroischen Vertreter eines Mediums, das auch heute nichts von
seiner Faszination eingebüßt hat. Man muß nur selbst Held
genug sein, sich darauf einzulassen. |
| Ausführlichere Angaben zum Thema über e-mail beim Verfasser des Artikels: medienobservationen@lrz.uni-muenchen.de |
Sämtliche Beiträge
dürfen ohne Einwilligung der Autoren ausschließlich zu privaten
Zwecken genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.
© Medienobservationen 1999.