Daniel Krause
Gibt es unheimliche
Musik?
Ein Antwortversuch.
Es gibt das Unheimliche in
der Musik – überall dort, wo die Brüchigkeit der musikalischen
Weltordnung aufscheint, zumal in solchen Klängen und Modulationen,
die de iure unzulässig sind, aber wie nebenbei zu Gehör gebracht
werden, als Teil des musikalischen Alltags. Dergleichen ist weit unheimlicher
als effektsichere Soundtracks zu Mystery-Filmen und allerlei Kakophonien.
Mephisto ist kein Schreihals.
1. Zu Beginn
Ein vielzitiertes Aperçu Franz Schuberts besagt,
er kenne keine fröhliche Musik. Einiges spricht dafür, dass
er Recht hat. Zwar gibt es Humor in der Musik, besonders bei Haydn: Das
reicht vom derben 'Furzen’ des Fagotts zu süffisanten harmonischen
Wendungen und – nicht zuletzt – zur Parodie kompositorischer
Einfalt. (1) Auch gibt es heitere Stimmungen, speziell
in jenen Sätzen, die mit 'Allegro’ oder 'Andante’ überschrieben
sind. 'Allegria’ meint ja nichts anderes als Heiterkeit. Doch Fröhlichkeit?
Man müsste bis Rosamunde hinabsteigen (nicht Schubert ist gemeint!).
Ob solche schenkelklopfende Lustigkeit nicht zugleich die Traurigkeit
der Depravation verströmt, das mag hier offen bleiben. Für die
'Ernste Musik’ jedenfalls wird man Schubert zustimmen müssen.
Wir stellen nun eine andere (gleichwohl ähnlich gelagerte) Frage:
Gibt es unheimliche Musik? Allzu leicht verführt sie zur haltlosen
Spekulation. Wir wollen nüchtern bleiben, auch um den Preis philisterhaften
Biedersinns.
2. Das Unheimliche in der Musik
Es gibt einen 'direkten Draht’
vom Klang durchs Ohr zum Herzen, denn manche Klänge scheinen bei
allen Hörern Unbehagen oder – wenigstens – Staunen zu
erregen. Hier sind die Tremoli am Beginn einiger Brucknersinfonien zu
nennen. Sie bezeichnen (in Bruckners Ton-Symbolik) das Chaos am Anfang
der Welt – 'der Geist schwebt über den Wassern’) –,
einen Zustand vor der Verfestigung ontischer Strukturen. Das muss uns
be-fremden. Es kommt wenigstens in die Nähe des Unheimlichen.
Nun gibt es einen gewichtigen Einwand: Ist diese Erscheinung universell?
Empfänden die Eskimo oder die Griechen genauso? Zweifel sind angebracht.
Wir tun gut daran, das Unheimliche als 'anthropologische Konstante’
fahren zu lassen. (2)
Betrachten wir also den Aufbau
'unserer’ musikalischen Welt: der neuzeitlichen Kunstmusik des Westens.
(Die meisten 'Volksmusiken’ und die Pop-Musik ahmen sie nach.) (3)
i) Es ist keine Selbstverständlichkeit,
dass zwischen Tönen (regelmäßige Schwingung) und Geräuschen
(unregelmäßige Schwingung) unterschieden wird. Nicht wenige
außereuropäische Kulturen verzichten auf diese Trennung. Für
unsere Tradition ist sie wesentlich.
ii) Wie das Frequenzspektrum
eingeteilt wird, das hängt von kontingenten Setzungen ab –
und variiert nach Zeit und Ort. (4) Im Allgemeinen
wird im 18. und 19. Jahrhundert tiefer „eingestimmt“ als heute.
Der „Kammerton“ (a’) liegt heute meist bei circa 440
Hz, früher waren es nicht selten 415 Hz. (5)
iii) Welche Intervalle bevorzugt werden –
auch das ist kontingent. In unserer Musikkultur sind es Quint und Quart.
iv) Wie Intervalle zu Tongeschlechtern und
Tonarten zusammengefasst werden – kontingent. Heute werden zwei
Tongeschlechter 'postuliert’: Dur und Moll (und entsprechende Tonarten:
C-Dur, D-Dur etc.). Am Rande haben sich die mittelalterlichen „modalen“
Tongeschlechter erhalten.
v) Welche Übergänge zwischen Tonarten
zugelassen werden – auch dies ist kontingent. Modulationen über
die Quint (d.h. die Dominante), die Quart (Subdominante) und die Terz
(Mediante) sind am wahrscheinlichsten.
Die drei letzten Festlegungen lassen sich am
berühmt-berüchtigten Quintenzirkel ablesen. Außerhalb
des 'Zirkels’ sind die Dur-Tonarten angeordnet, innerhalb des 'Zirkels’
die Moll-Tonarten. Jede Dur-Tonart ist von der ihr zugeordneten Moll-Tonart
eine Terz entfernt, von der nächsten Dur-Tonart eine Quint (nach
rechts) bzw. eine Quart (nach links). Damit ist vorgegeben, wie die Übergänge
zwischen Tonarten („Modulationen“) zu gestalten sind. Kurzum:
Der Quintenzirkel beschreibt die harmonische Ordnung 'unserer’ Musik.
Er grenzt den Tonartenraum ein und legt dessen innere Zusammenhänge
fest.
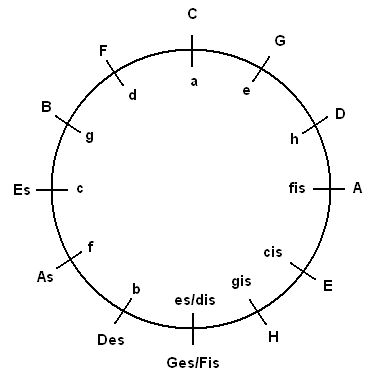
Quelle: http://quintenzirkel.know-library.net
Was hat es nun mit dem Unheimlichen in der Musik auf
sich?
Die harmonische Ordnung kann aufgelöst, de-komponiert werden –
Ravels La Valse beschreibt diesen Vorgang. Sie kann in statu nascendi
vorgeführt werden, ungefestigt, tastend – am Anfang mancher
Brucknersinfonie. Sie kann außer Kraft gesetzt, suspendiert werden
– das geschieht in der freien Atonalität Schönbergs (um
1910). Zuweilen wird sie ersetzt – durch eine andere Ordnung, z.B.
Schönbergs Zwölftontechnik (um 1920), Hábas Vierteltontechnik,
Boulez’ Serialismus. Allein das ist nicht das Unheimliche in der
Musik. Solche Kompositionen mögen uns aufrütteln oder in Rage
versetzen. Unheimlich sind sie uns nicht. Das zeigen die Reaktionen des
Publikums. Meist lehnt es dergleichen vehement ab, mit selbstgewisser
Borniertheit und kernigem Ressentiment. Es glaubt noch immer zu wissen,
was sich gehört: Die 'Ordnung der Töne’ wird nicht erschüttert.
Die Regeln sind weiter in Kraft. (6) Unheimlich wird
es erst dann, wenn wir nicht mehr gewiss sind, was 'geht’ und was
nicht. Wenn die Brüchigkeit und Kontingenz der 'Welt-Ordnung’
zu Gehör kommt – und sei es für den Augenblick. Wenn hörbar
wird, dass alles auch anders sein könnte – dann wird uns 'ganz
anders’. Effekt, Lautstärke, Kraftmeierei sind nicht erforderlich
für solche Irritationen. Das Unheimliche lärmt nicht. Im Gegenteil:
Es sind die Unter- und Zwischentöne, die uns verunsichern. Jene Harmonien
und Modulationen, die in der 'Ordnung der Töne’ nicht vorgesehen
sind, aber wie nebenbei, wie Trivialitäten daherkommen. Mezzoforte
oder Piano (nicht Forte oder Pianissimo) lauten die typischen Vortragsbezeichnungen.
Die größten Katastrophen geschehen im Vorübergehen. (Der
Teufel steckt im Detail.) Dann spüren wir: Kein Halt, nirgends.
Wo finden sich solche Verstörungen? Dort,
wo so mancher reinen Wohlklang vermutet: Bei Mozart, z.B. im Dissonanzenquartett
KV 465. Zunächst scheint der Meister von Harmonik nichts wissen zu
wollen: Die Welt ist aus den Fugen. Das ist nicht eigentlich unheimlich,
wir wiesen darauf hin. Unheimlich wird es danach: Die Dissonanzen haben
unvermittelt ein Ende. Es beginnt diatonischer Alltag – als sei
nichts geschehen: Ein dem Anschein nach harmloses Thema, C-Dur. Die Selbstverständlichkeit
des Übergangs schockiert.
Ein anderes Beispiel: Das Sanctus von Schuberts Messe Es-Dur durchmisst
vier (teils abseitige) Tonarten – in sieben Takten. Zugegeben: Sakralmusik
ist prädestiniert, 'jenseitige’ Klänge hören zu lassen.
Doch der harmonische Kontext der Messe ist relativ konventionell. (Das
gilt auch für Mozarts und Beethovens Beiträge zum Genre.) Kein
Zufall also, dass die wilden Modulationen des Sanctus uns frösteln
lassen.
Wohlgemerkt: Dies sind Werke des Kanons, gängiges Konzertrepertoire.
Die 'Klassische Musik’ trägt das Prinzip ihrer (harmonischen)
'Dekonstruktion’ in sich. Eben darum ist sie Kunst, nicht Kitsch.
3. Zum Schluss
Wie lässt sich die Richtigkeit unseres
Antwortversuchs prüfen? Wir machen dreierlei geltend: Unser Argument
ist verständlich. (Das könnte auch anders sein.) Es ist kohärent.
(Daran halten wir fest, bis zum Nachweis des Gegenteils.) Unser Argument
ist im Ergebnis plausibel: Es weist diejenigen 'Stellen’ als unheimlich
aus, die unserer Alltagserfahrung unheimlich scheinen.
Hinweis
Die Musiker des Alban-Berg-Quartetts
und das Franz-Schubert-Quartetts haben gute Einspielungen des Dissonanzenquartetts
vorgelegt.
Wolfgang Sawallisch und der Sächsischen Staatskapelle verdanken wir
eine strenge, unsentimenale Lesart der Messe Es-Dur. Sie bringt das Verstörende
dieser Musik umso eindrucksvoller heraus.
Fußnoten
- Das bekannteste Beispiel ist Mozarts Ein musikalischer
Spaß, KV 522. Hier werden dümmliche Komponisten aufs Korn
genommen. (zurück)
- Das schließt wohlgemerkt nicht aus, dass unterschiedliche
musikalische Erscheinungen bei Angehörigen verschiedener Kulturen
ähnliche oder gleiche körperliche und geistige Empfindungen
auslösen. (zurück)
- Kein Zweifel: Längst gibt es Musik, die sich außerhalb
dieser Tradition einordnet, man denke nur an Minimal Music oder die
Kompositionen Feldmans. Für diese Art Musik sind wir nicht zuständig.
Wir können lediglich vermuten, dass sie ihr eigenes Unheimliches
hervorgebringt: indem sie Ordnungsmuster etabliert – und unterläuft.
(zurück)
- Eine entscheidende Zäsur ist die Einführung
der „gleichschwebenden Temperatur“ Mitte des 18. Jahrhunderts.
Hier beginnt die musikalische Neuzeit: Von jetzt an werden Instrumente
so gestimmt [=temperiert], dass sie in alle Tonarten modulieren können.
Erst jetzt wird es möglich, den Tonartenraum auszuschöpfen.
Aus diesem Anlass hat Bach sein Wohltemperiertes Klavier geschrieben.
(zurück)
- Dass niedriger eingestimmt wurde, hat praktische Gründe: Die
Darmsaiten der alten Streichinstrumente konnten höhere Spannungen
(mithin höhere Töne) weniger leicht verkraften als moderne
Stahl- oder Nylonsaiten.
Die hohe Stimmung unserer Tage hat einen bemerkenswerten Effekt: Die
Musik des Barock (sowie der Klassik und der Romantik) wird um einen
Halbton zu hoch aufgeführt, gleichsam transponiert. Auch daher
erklärt sich der Erfolg der 'Originalklangbewegung’. (zurück)
- Der Tritonus (die übermäßige Quart) kann also nicht
als unheimlich gelten – obwohl er niemand geringeren als den
Leibhaftigen symbolisiert („diabolus in musica“): Er lässt
die symbolische Ordnung der Töne intakt, ja er bestätigt
sie. (zurück)
|